Kein Mensch käme, brächte eine Plattenfirma heute eine Aufnahme aus den fünfziger Jahren mit Maria Callas, Renata Tebaldi oder Martha Mödl heraus, auf den Gedanken, „Mir aus den Ohren, Erhabene!“ zu rufen und sich in drei langen Spalten darüber auszulassen, daß es „heute so nicht mehr gehe...“ 50 Jahre sind 50 Jahre. Die Verhältnisse haben sich gewandelt, auch das Verhältnis zu Sprache und Musik. Man hörte die alten Aufnahmen, bewunderte die hohe Stimmkultur, die Ausdruckskraft der Sängerinnen (oder auch nicht), beklagte den Verlust an Handwerk (oder auch nicht), den man heute feststellen kann. Alles ohne besondere Aufgeregtheit. Warum nun reagiert der Chef-Theaterkritiker der FAZ wie von der Tarantel gestochen auf eine 50 Jahre alte Aufnahme, die ein kleines Label, die Edition Mnemosyne, von Heinrich von Kleists „Penthesilea“ kürzlich in seiner Reihe „HörBühne' herausgab, und verfaßt auf der neu eingerichteten 'Hörbuch'-Seite der Literatur-Beilage der FAZ zur Frankfurter Buchmesse eine so scharfe Polemik gegen den „Renegaten“ Schwiedrzik und das Programm seiner 'HörBühne'? Warum beschimpft er die große alte Maria Becker, der er vor zwei Jahren anläßlich ihres 80.Geburtstages noch überschwenglich gefeiert hatte, als „Konsonantenkampfhenne“ und denunziert ihr Sprechen als hochbrillant tragödisches Ausspucken eines Reclam-Heftes? Irgendwie muß mit der Herausgabe der „Penthesilea“ und anderer klassischer Stücke in der 'HörBühne' ein Nerv (nicht nur) dieses Kritikers getroffen worden sein. Zumindest fühlt ein Teil des Publikums sich provoziert, während ein anderer in heftige Begeisterung ausbricht. Es gibt keine Ausgabe der 'HörBühne' – von Shakespeares 'König Lear' über Hebbels 'Die Nibelungen', Grillparzers „Das goldene Vließ', Nestroys „Das is a verruckte Idee“ bis zu Goethes „Iphigenie auf Tauris“ und Kleists „Penthesilea“, die nicht – sei es in Frankfurt beim HR und Börsenverein, sei es in Tübingen beim Seminar für Allgemeine Rhetorik – als „Hörbuch des Monats“ ausgezeichnet wurde. Wiederholt und nachdrücklich wurde der Wunsch formuliert, Mnemosyne, die Mutter der Musen und Göttin der Erinnerung, möge noch weitere Kostbarkeiten dieser Art aus ihrer Schatztruhe freigeben. Offenbar gibt es Menschen (auch in den zuständigen Jurys), die die Willkür des heutigen Regietheaters leid sind, die den Niedergang der Sprechkultur auf den deutschsprachigen Bühnen beklagen und die sich durch das Anhören alter Aufnahmen mit Maria Becker, Maria Wimmer, Fritz Kortner, Bernhard Minetti, Will Quadflieg, Hermann Schomberg u.a. gern daran erinnern lassen, wie noch in den fünfziger Jahren (trotz der Korrumpierung der Sprache durch den Nationalsozialismus) auf deutschsprachigen Bühnen gesprochen wurde. 3000 Tausend mal wurde die Ausgabe des „König Lear“ (mit Fritz Kortner in der Titelrolle), die 1999 in der Edition Mnemosyne erschien, inzwischen verkauft. Das ist für einen Ein-Mann-Verlag, der ohne Personal, ohne Apparat und ohne Werbeetat auskommen muß, ein erstaunliches Ergebnis. Auch Gerhard Stadelmaier gehört zu den Menschen, die die sprachliche Verödung der deutschen Bühnen lebhaft beklagen – und gelegentlich heftig geißeln. Den Inszenierungen von Andrea Breth am Wiener Burgtheater (zuletzt Schillers „Maria Stuart“ und Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“) widmete er ausführliche, geradezu hymnische Besprechungen, weil sie einen Gegenkurs zu der allgemeinen Misere erkennen lassen. Hat er nicht bemerkt, daß eben diese Regisseurin, Andrea Breth, zu den Mitherausgebern und künstlerischen Beratern der 'HörBühne' in der Edition Mnemosyne gehört? Der Verleger der Edition Mnemosyne beansprucht nicht, mit der Herausgabe der alten Aufnahmen einen schöpferischen Beitrag zur Neugestaltung des Sprechtheaters zu leisten. Es geht lediglich darum, mit der Veröffentlichung der alten Aufnahmen daran zu erinnern, welchen Verlust das deutschsprachige Theater mit der Liquidierung der Sprache, die mit der Vertreibung der jüdischen Schauspieler 1933 begann und 1968 triumphal zu Ende gebracht wurde, erlitten hat. Gestehen wir es doch ein: Das deutsche Sprechtheater befindet sich heute in einer tiefen Krise. Die Entwicklung auf den deutschen Bühnen hat in den letzten Jahrzehnten zu einer unerhörten Intellektualisierung und Ideologisierung des Theaters geführt (wozu der Autor dieser Zeilen anfangs auch beitrug). Das 'Regietheater' treibt seither wunderliche Blüten und das Publikum, sofern es noch Ansprüche an das Theater hat, aus dem Theater. Es wurden Mittel entwickelt, das veränderte Lebensgefühl und Bewußtsein der jüngeren Generation - zum Beispiel durch mehr Körperlichkeit und 'action' auf der Bühne - zum Ausdruck zu bringen. Aber die Machtergreifung der Regisseure und Dramaturgen war in der Regel begleitet von einem unbeschreiblichen Verfall handwerklichen Könnens in bezug auf den zentralen Code des Theaters: die Sprache (und - damit verbunden - der Entmündigung der Schauspieler auf dem Theater). Es ist historisch zwar verständlich, daß die jüngere Generation der Theaterleute sich von dem 'hohlen Pathos' abwandte, das sich in der Zeit des Nationalsozialismus auf den Bühnen breitgemacht hatte. Aber mit der Abschaffung des 'hohlen Pathos' hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es kam zu einer Vernachlässigung jeglicher Sprechkultur und einem immensen Verlust rhetorischer Fähigkeiten. Welche Schauspieler sind heute noch in der Lage, eine Ballade zu rezitieren? Welches Theater verfügt noch über ein Ensemble, das in der Lage ist, einen Klassiker aufzuführen? Man kann sie im deutschsprachigen Raum an einer Hand aufzählen. Verbirgt sich hinter den heute üblichen Exaltationen der Regie nicht eine tiefe Verlegenheit? Man hat seit einem Viertel Jahrhundert einen anderen Typus von Schauspieler rekrutiert, bei dem es eher auf Beweglichkeit als auf sprachliche Fähigkeiten ankommt. Man hat die großen alten Schauspielerinnen und Schauspieler wie z.B. Maria Becker oder Will Quadflieg verhöhnt und ins Abseits gedrängt (um einige von ihnen spät, viel zu spät “wiederzuentdecken” und sie nun als Greise kleine Rollen spielen oder Prologe sprechen zu lassen). Man hat das sprachliche Handwerk derart verkommen lassen, daß man - selbst wenn man wollte - gar nicht mehr in der Lage wäre, eine Klassiker-Aufführung von Format zustande zu bringen. (Zwei, drei Ausnahmebühnen in Wien, München oder Berlin, die als Zufluchsstätten für die letzten großen Sprecher dienen, bestätigen nur die allgemeine Regel.) Zu untersuchen wäre natürlich, welche weiteren Faktoren zum Verfall der Sprechkultur auf den Bühnen beigetragen haben. Kann eine Gesellschaft, die dem Pathos keinerlei Bedeutung mehr beimißt, ja, es geradezu verketzert, überhaupt noch einen Sinn für Rhetorik und Sprechkultur entwickeln? Und, was das Theater selbst angeht: Hat die Verallgemeinerung der Brecht’schen Regie- und Schauspielmethoden - z.B. das Abstellen auf 'typische Haltungen', 'sozialen Gestus' usw. - bei allem Fortschritt, den es in bezug auf die Darstellung gesellschaftlicher Verhältnisse mit sich brachte, nicht auch zu einer Vereinseitigung des schauspielerischen Handwerks, d.h. zu einer Vernachlässigung der Sprache beigetragen? Hat nicht die rasante Entwicklung der modernen Aufnahme-, Verstärkungs- und Wiedergabetechnik die Vernachlässigung handwerklicher Fähigkeiten bei den Schauspielern bzw. Sprechern stark befördert? Ist nicht das Mikrophon ein Todfeind der Sprechkultur auf der Bühne? Oder zumindest eine Verführerin, die Entwicklung elementarer Fähigkeiten sprachlichen Handwerks außer acht zu lassen? Der Rückgriff auf die alten Aufnahmen kann das aufgezeigte Problem natürlich nicht lösen. Wenn wir in unserer Ratlosigkeit auf das Arsenal historischer Aufnahmen zurückgreifen, dann aus dem einzigen Grund: um die verlorene (und wieder zu erarbeitende) Höhe sprachlicher Kultur deutlich zu machen. Die Archive einiger Rundfunkanstalten bergen große Schätze, vor allem das Archiv des WDR in Köln, denn hier wirkte z.B. Wilhelm Semmelroth, der nach dem Zweiten Weltkrieg die “Hörspiel”-Abteilung des NWDR (später WDR) aufbaute und sich – in der Tradition Ernst Hardts, der diese Linie in Köln schon vor 1933 angelegt hatte – auf die Inszenierung von klassischen Texten konzentrierte. Für Ernst Hardt und Wilhelm Semmelroth war das Theater – nicht nur in handwerklicher Hinsicht – die unbestrittene Grundlage aller Arbeit am “Hörspiel”. Wegen ihrer engen Verbindung zum Sprechtheater sind die Funkproduktionen klassischer Stücke daher auch theaterhistorisch aufschlußreich: Sie versammeln die erste Garde deutschsprachiger Schauspieler, die man sonst – da die Theater ihre Aufführungen zu dieser Zeit nur in Ausnahmefällen aufzeichneten – nicht mehr hören könnte. Und sie dokumentieren bis zum gewissen Grade noch den “hohen Ton” und das einst so entfaltete Arsenal rhetorischer Ausdrucksmittel des Theaters, während heute in den Studios nur noch der “private Ton” des Sprechers als zulässig gilt: die Vermittlung zum Hörer übernimmt heute die Technik, d.h. Mikrophon, Verstärker und Lautsprecher. Je kehliger und – in rhetorischen Sinne – unentwickelter ihre Stimme, desto begehrter sind die Sprecher. Viele dieser Studiogrößen haben nie auf der Bühne gestanden oder könnten sich dort mit ihren einseitig entwickelten Mitteln, die auf die verstärkende Technik angewiesen sind, auch nicht behaupten. Eine dreihundert Jahre währende Phase deutscher Theatergeschichte, von Goethe und Schiller auf dem Weimarer Theater begonnen und gegen den damaligen Zeitgeschmack, der sich Stücken eines Kotzebue ausdrückte, durchgekämpft, ist unter den Schlägen der Achtundsechziger zu einem Ende gekommen, ähnlich wie die Peking-Oper in China unter den Schlägen der kulturrevolutionären Roten Garden zusammenbrach und heute nur noch als Karikatur ihrer selbst und zum Ergötzen ausländischer Touristen fortvegetiert. Ich schlage vor, daß die Literatur-Redaktion der FAZ, nachdem sie am 8. Oktober eine volle Breitseite gegen die “Penthesilea” der Edition Mnemosyne abgelassen hat, diese Stellungnahme veröffentlicht, nicht als Leserbrief, sondern als Eröffnung einer länger andauernden Diskussion über den Zustand des deutschsprachigen Sprechtheaters.
 |
|||||
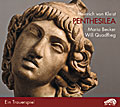 |
|||||
| Wolfgang Matthias Schwiedrzik EDITION MNEMOSYNE Neckargemünd / Wien 20.10.2002 |
|||||